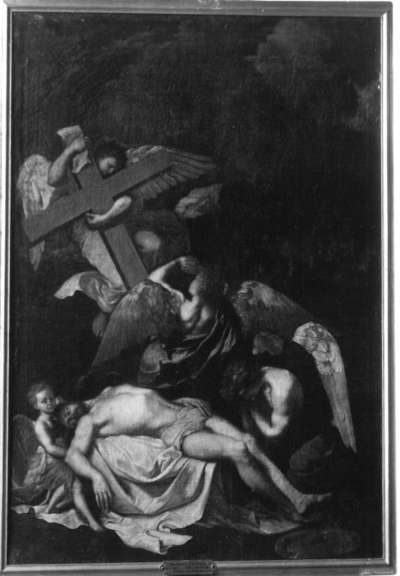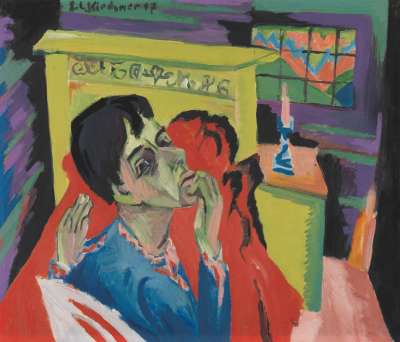Pieter Bruegel d. Ä.
(1525-1569)
Das Schlaraffenland,
1567
Material / Technik / Bildträger
Eichenholz
Maße des Objekts
51,5 x 78,3 cm
Ausgestellt
AP OG Kabinett 11
Erwerb
1917 erworben; ehem. kaiserliche Sammlung Prag
Bestand
Bayerische Staatsgemäldesammlungen - Alte Pinakothek München
Zitiervorschlag
Pieter Bruegel d. Ä., Das Schlaraffenland, 1567, Bayerische Staatsgemäldesammlungen - Alte Pinakothek München, URL: https://www.sammlung.pinakothek.de/de/artwork/01G1P9YLkE (Zuletzt aktualisiert am 11.09.2023)
Hier wird menschliches Fehlverhalten wie Müßiggang und Völlerei thematisiert, das, wie die Vertreter dreier Stände (Soldat, Bauer, Gelehrter) zeigen, alle gesellschaftlichen Schichten durchdringt. Trägheit und die Hingabe an die Laster sind eng miteinander verbunden.